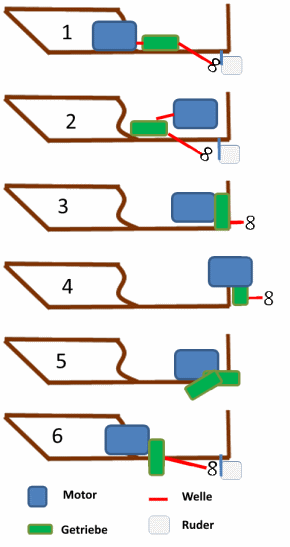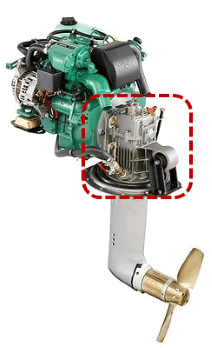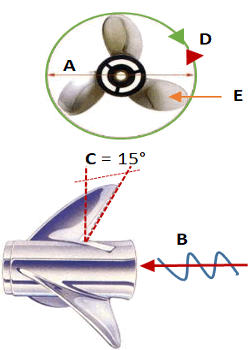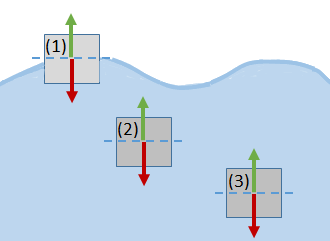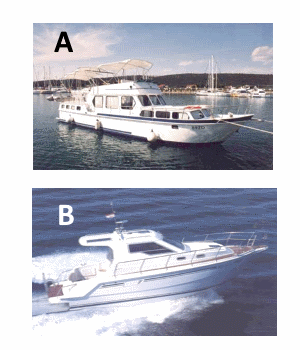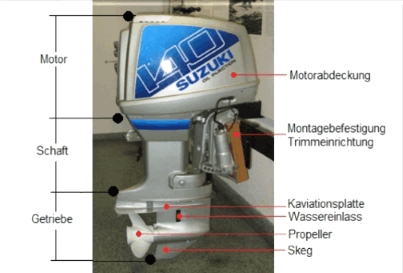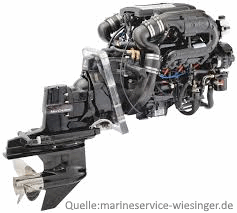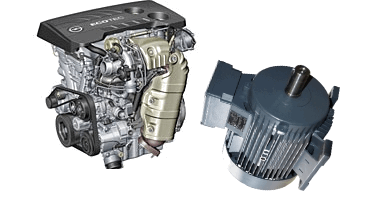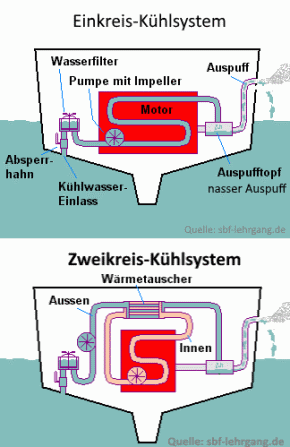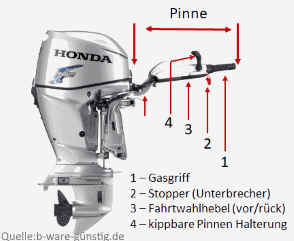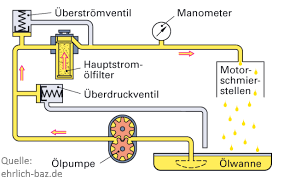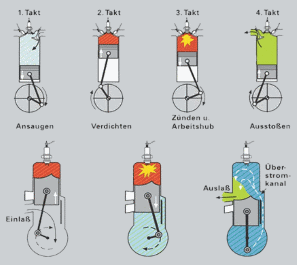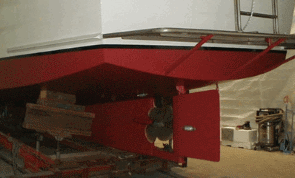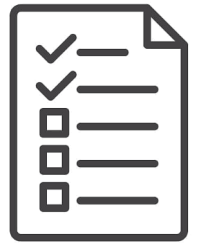ANTRIEB
Antriebsarten
In Sportbooten werden verschiedene Antriebsarten genutzt:
1) Konventioneller Antrieb (Starre Welle): Beim konventionellen Antrieb befinden sich die Einheiten Motor, Getriebe, Schraube auf einer Ebene hintereinander. Die Kraft muss nicht umgeleitet werden. Wird auf fast allen klassischen Verdrängerschiffen sowohl auf Segelbooten als auch auf Motorbooten eingesetzt.
Vorteil: Einfache Bauart.
Nachteil: Großer Platzbedarf.
2) V - Antrieb: Auf Verdrängerschiffen. Dem konventionellen Antrieb sehr ähnlich, nur wird die Kraft hier nicht direkt übertragen sondern umgelenkt. Durch diese Umlenkung um 180° ergibt sich als Vorteil ein geringerer Platzbedarf als beim konventionellen Antrieb.
Die Nachteile dabei: Das Gewicht liegt sehr weit im Heck und das Getriebe ist sehr komplex im Aufbau - und damit u. U. störungsanfällig.
3) Z - Antrieb: In Gleitern und Halbgleitern eingesetzt. Erlaubt sehr hohe PS-Zahlen und hohe Geschwindigkeiten.
Vorteil: Große Kraftentfaltung.
Nachteil: Getriebe und Motor bilden eine Einheit. Steuerung erfolgt durch Anschub, ohne Antrieb keine Lenkung.
4) Außenborder: Wird oftmals in Gleitern und Halbgleitern eingesetzt. Erlaubt hohe PS-Zahlen und hohe Geschwindigkeiten.
Vorteil: Preiswerter als Z-Drive.
Nachteil: Schlechtere Manövriereigenschaften als dieser und ohne Motorleistung keine Steuerung.
5) Wasserstrahlantrieb: Wird in schnellen Gleitern, Halbgleitern und JetSkis eingesetzt. Erlaubt hohe Geschwindigkeiten. Wasser wird unter dem Boot angesaugt, verdichtet und mit großer Geschwindigkeit hinten ausgestoßen. Durch Umlenkung des Wasserstromes wird gelenkt.
Vorteil: Keine außen liegende Schraube, keine Beschädigung möglich, keine Verletzungsgefahr.
Nachteil: Antrieb kompliziert und gekapselt. Steuerung erfolgt durch Anschub, ohne Antrieb keine Lenkbewegungen des Fahrzeugs möglich.
6) Saildrive: Wird bei Segelbooten eingesetzt. Erlaubt den Vortrieb oder Manöver ohne Wind.
Vorteil: Einfache Bauart
Nachteil: Schlechtes Manövrierverhalten in der Rückwärtsfahrt (Radeffekt).