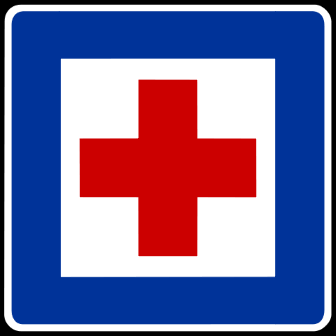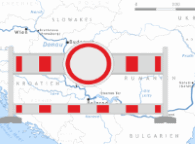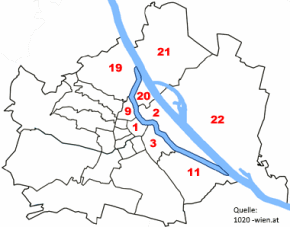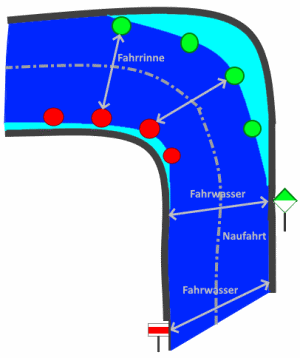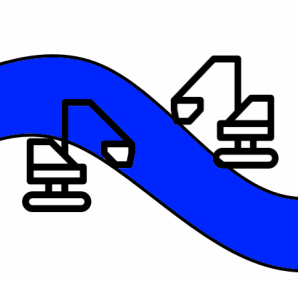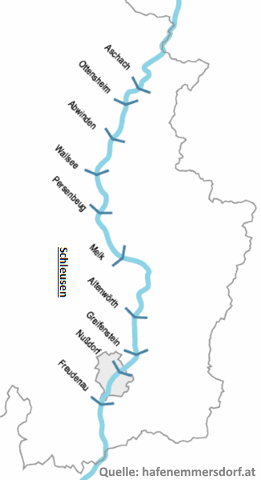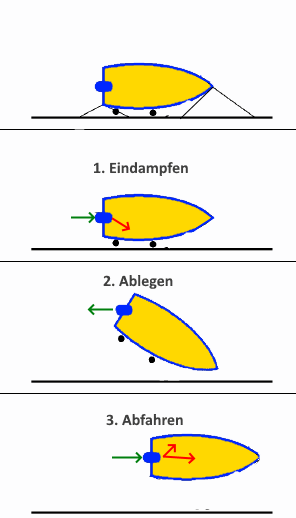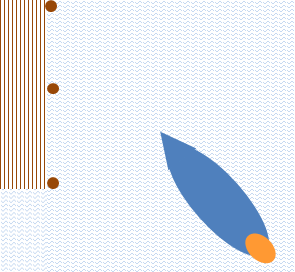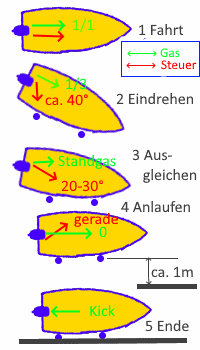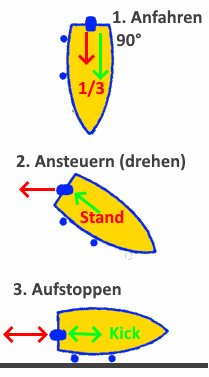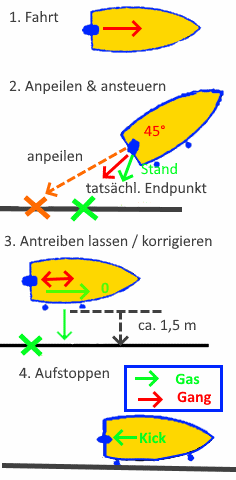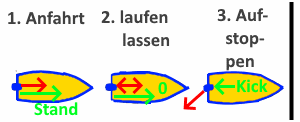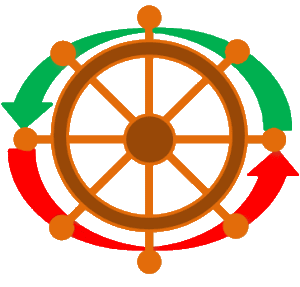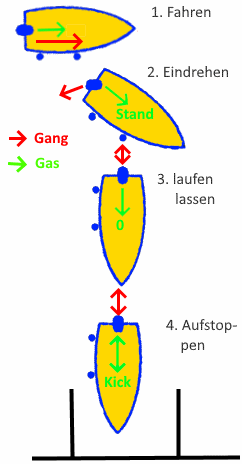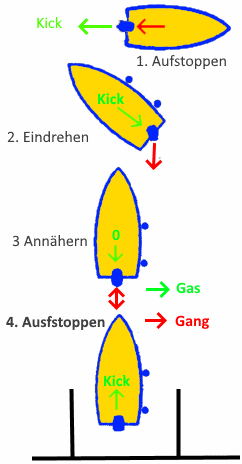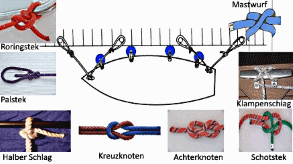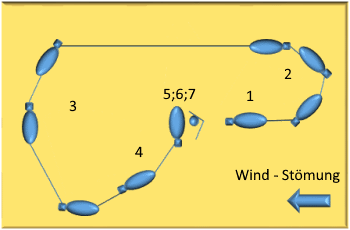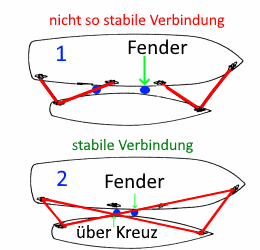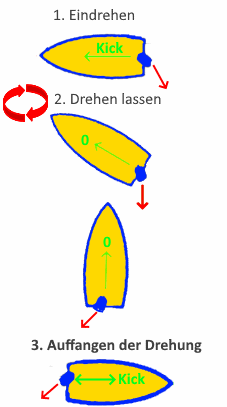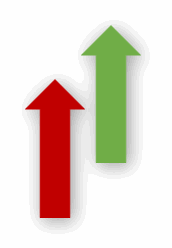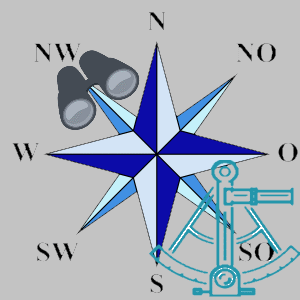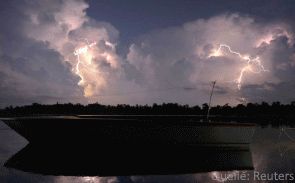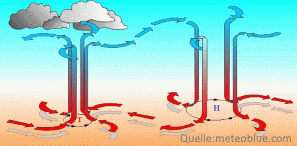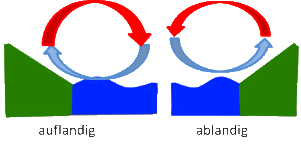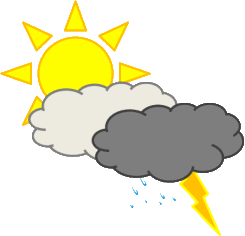ALLGEMEIN
Fahrregel
Fahrregeln sind für alle Teilnehmer am Schiffsverkehr verbindlich. Wer sich nicht an sie hält gefährdet sich und andere.
1. Anhängen oder Anlegen an ein anderes Fahrzeug oder das Mitfahren im Sogwasser ist ohne Erlaubnis des Schiffsführers des anderen Fahrzeuges verboten.
2. Treibenlassen ist verboten.
3. Ein Fahrzeug, das Bug zu Berg mit im Vorwärtsgang eingekuppelter Antriebsmaschine sich zu Tal bewegt, gilt nicht als treibendes Fahrzeug, sondern als Bergfahrer.
4. Das Schleifenlassen von Ankern, Ketten und Trossen ist mit Ausnahme von kleinen Bewegungen auf Liegeplätzen verboten.
5. Fahrzeuge müssen ihre Geschwindigkeit so einrichten (auf das zur Steuerung notwendige Maß vermindern), dass Wellenschlag oder Sogwirkung keine Schäden an stillliegenden oder in Fahrt befindlichen Fahrzeugen oder an Anlagen verursachen können.
6. Sportfahrzeuge haben bei beschränkten Sichtverhältnissen das Fahrwasser unverzüglich freizumachen.
7. Wellenschlag oder Erzeugung von Sogwirkung sind verboten, besonders:
a) Vor Hafenmündungen und in der Nähe von Fahrzeugen.
b) In der Nähe von Fahrzeugen, die auf den üblichen Liegestellen stillliegen.
c) In der Nähe nicht frei fahrender Fähren.
d) Auf Strecken die durch das Schifffahrtszeichen "Verbot, Wellenschlag zu verursachen" gekennzeichnet sind.
e) Bei der Vorbeifahrt an Fahrzeugen, Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen, die gemäß Bezeichnung vor Wellenschlag zu schützen sind (1 rotes über 1 weißem Licht oder entsprechende Flaggen). Sie haben außerdem einen möglichst großen Abstand zu halten.